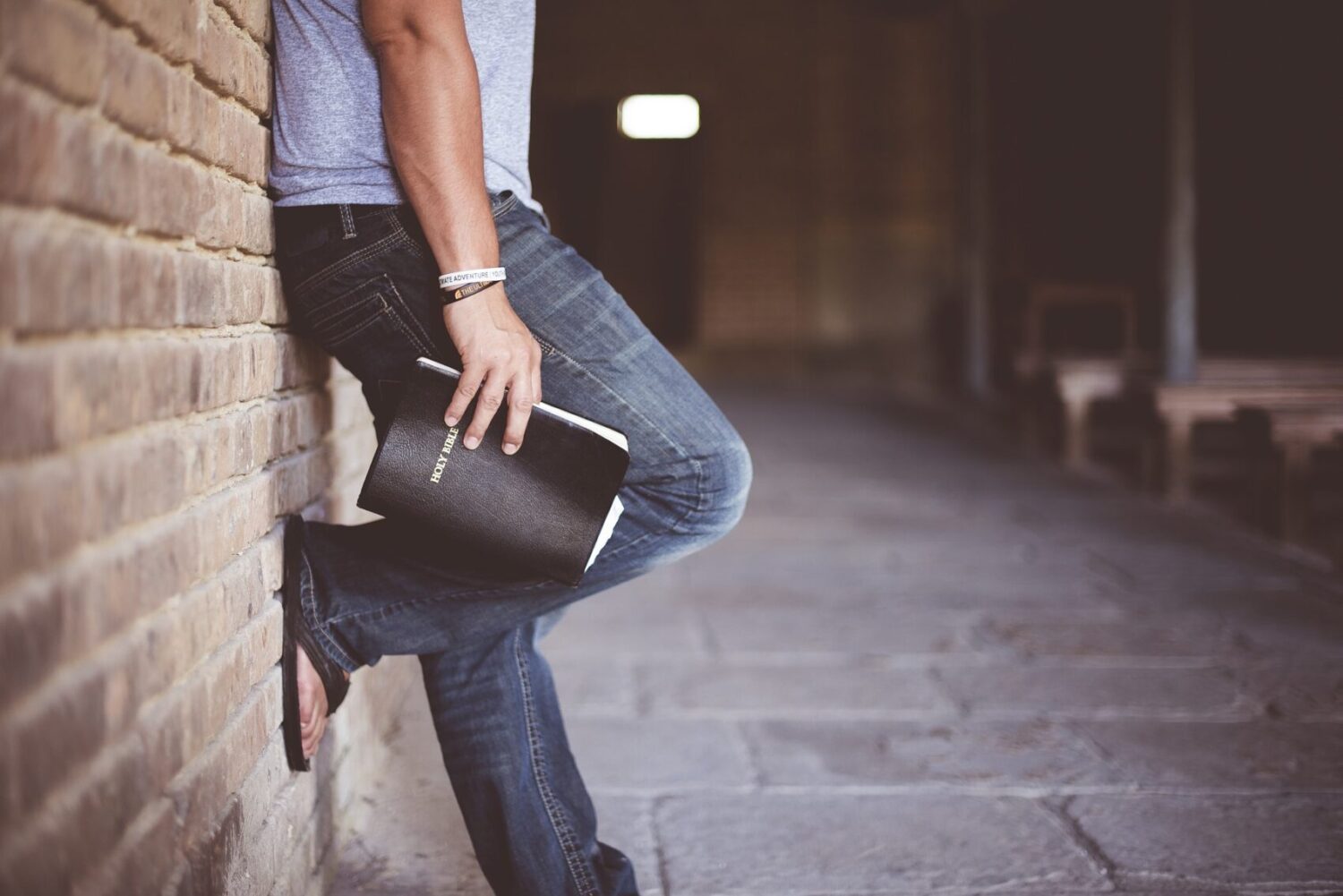Viele Menschen sehen einen Widerspruch darin, LGBTQIA+ zu sein und dennoch religiös zu sein. Doch ist es wirklich so, dass diese beiden Parameter einer Persönlichkeit sich ausschließen? Und ist Religion wirklich schädlich für LGBTQIA+ Personen – oder kann sie auch hilfreich sein?
Studienlage
Traditionell haben Psychologen Konflikt- und Stressmodelle herangezogen, um die Beziehung zwischen Religiosität oder Spiritualität und LGBTQIA+ Leben zu verstehen. Studien haben oft auf einen negativen Einfluss von Religion und Spiritualität auf die Gesundheit von LGBTQIA+ Personen hingewiesen, besonders wenn in der Religion Homosexualität negativ dargestellt wird. Dennoch ist es wichtig anzuerkennen, dass sexuelle und geschlechtliche Minderheiten trotz struktureller Stigmatisierung vielschichtige Beziehungen zur Religion und Spiritualität haben können. Manche LGBTQIA+Personen entscheiden sich bewusst dafür, ihre bereits vor dem Coming Out bestehende Religion weiterhin auszuüben oder sie finden nach ihrem Coming Out zur Spiritualität.
Kürzlich wurde in einer wegweisenden Meta-Analyse eine kleine, aber positive Beziehung zwischen Religiosität und Spiritualität und dem Wohlbefinden sexueller Minderheiten festgestellt: Es wurde gezeigt, dass LGBTQIA+ Personen Religion und Spiritualität auf verschiedene Weisen nutzen können, um mit Stressoren umzugehen und ein erfülltes Leben zu führen – genau wie cis-heterosexuelle Personen auch.
Religiosität in der Therapie
Es ist wichtig, dass Psycholog*innen ihr Verständnis erweitern, um auch positive religiöse und spirituelle Erfahrungen von LGBTQIA+ Personen anzuerkennen. Therapeuten sollten eine inklusive Umgebung schaffen, in der LGBTQIA+ Personen offen über ihre religiösen Überzeugungen sprechen können, ohne Angst vor Vorurteilen oder Diskriminierung haben zu müssen.
Die einzigartige Schnittstelle von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt mit religiösen oder spirituellen Überzeugungen schafft ein vielfältiges und komplexes Erlebnisgeflecht, das anerkannt und respektiert werden sollte. Durch die Anerkennung dieser facettenreichen Identitätsaspekte können Psycholog*innen ihren Klient*innen besser dabei helfen, die Herausforderungen, Konflikte und persönlichen Wachstumschancen im Kontext ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identitäten sowie ihres Glaubens oder ihrer Spiritualität zu bewältigen.
Inklusive Ansätze fördern nicht nur die gelebten Erfahrungen von LGBTQ+ Personen, sondern unterstützen auch einen ganzheitlichen und kultursensiblen Zugang zur psychischen Gesundheit und zum Wohlbefinden.
Wichtige Bausteine einer Therapie
- Eine sichere und nicht-wertende therapeutische Umgebung ist unabdingbar, damit Individuen sich wohl fühlen, über ihre sexuellen und religiösen Identitäten zu sprechen.
- Es ist notwendig, die religiösen Überzeugungen der Klient*innen zu validieren und zu respektieren. Es gibt den sogenannten Sexual Minority and Religious Identity Integration Measure (SMRII), der genauere Zusammenhänge von Religion und sexueller Identität aufzeigen kann. Diese könenn dann eingeflochten werden in den individuellen Behandlungsplan.
- Möglicherweise sollten internalisierte Homophobie und religiöse Traumata besprochen werden, wenn in der Therapie ein Zusammenhang zwischen Religiosität und Selbstabwertung festgestellt wird. Dann kann gemeinsam die Quelle der negativen Überzeugungen der Klient*innen erforscht werden und nachfolgend können Bewältigungsstrategien identifiziert werden, um mit diesen Gefühlen umzugehen.
- Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz sind wichtige Bausteine. Daher lohnt es sich, Selbstfürsorgepraktiken wie Achtsamkeits- und Selbstmitgefühlsübungen durchzuführen, um das emotionale Wohlbefinden zu fördern. Neben der Praxis von Selbstmitgefühl könnte Selbstfürsorge für religiöse LGBTQIA+ Personen auch bedeuten, eine unterstützende Gemeinschaft zu finden. Dies könnte durch den Beitritt zu einer affirmativen religiösen Gemeinschaft, die Zusammenarbeit mit einer LGBTQIA+ Unterstützungsgruppe oder die Entwicklung eines Netzwerks „gewählter Familie“ geschehen, das einen sicheren und bestärkenden Raum bieten kann.
Quellen:
Lefevor, G. T., Davis, E. B., Paiz, J. Y., & Smack, A. C. (2021). The relationship between religiousness and health among sexual minorities: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 147(7), 647.
Lefevor, G. T., Etengoff, C., Davis, E. B., Skidmore, S. J., Rodriguez, E. M., McGraw, J. S., & Rostosky, S. S. (2023). Religion/Spirituality, Stress, and Resilience Among Sexual and Gender Minorities: The Religious/Spiritual Stress and Resilience Model. Perspectives on psychological science, 17456916231179137.